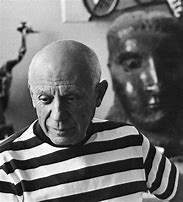Vor 10 Jahren fand in der Albertina Wien die Ausstellung »Welten der Romantik« statt. Für die Dauer der Ausstellung war Wien wieder die Hauptstadt der Romantik.
Romantik-Ausstellungen in Museen stoßen immer auf großes Interesse und lassen die Besucher dankbar und wie von selbst in die Museen strömen. Die Romantik fasziniert das Publikum nach wie vor mit ihren traumvergessenen Sujets: den Schluchten und Ruinen, luziden Minen und extrem schlanken Architektur. Doch „Welten der Romantik“ will nicht überwältigen, sondern ist didaktisch aufgebaut. Mit dem Mittel der Bilder zeigt sie, auf wie vielen thematisch auseinanderdriftenden Flüssen die künstlerische Strömung durch das 19. Jahrhundert führt.
Der reinen Vernunft traute man nicht länger. Lieber begrüßte man Geister wie den Erlkönig und andere Sagengestalten. Und Gespenster, wie sie zum Auftakt in der Albertina Goyas „Caprichos“ verkörpern. Zusammen mit seinem „Koloss“ von 1810, der lange als Werk des spanischen Meisters galt, nun aber seiner Werkstatt zugeschrieben wird. Ein Gemälde, in dem der Krieg als Riese durch die Landschaften poltert und sie verwüstet.
In Wien, einem der Geburtsorte dieser bedeutenden Strömung, zeigt die Albertina in Wien in Kooperation mit dem Kupferstichkabinett der Akademie der bildenden Künste eine Ausstellung mit rund 160 Werken ihrer wichtigsten Vertreter.
Wie konfessionell das alles geprägt war, gehört zu den Erkenntnissen der Ausstellung, obwohl es nicht im Vordergrund steht.
Doch sie zeigt die Differenzen in den 160 Zeichnungen, Stichen und Gemälden von Peter Cornelius, Friedrich Overbeck, Franz Pforr, Friedrich Wilhelm Schadow oder Karl Friedrich Schinkel. Einiges stammt aus dem Wiener Kupferstichkabinett, das für das Projekt eng mit der Albertina kooperierte. Anderes kommt aus dem Städel in Frankfurt, der Hamburger Kunsthalle oder der bayerischen Gemäldesammlung – von überall also, wo der romantische Gedanke festsaß.
Wie konfessionell das alles geprägt war, gehört zu den Erkenntnissen der Ausstellung, obwohl es nicht im Vordergrund steht. Die katholische Romantik erschließt sich über den Lukasbund. In Wien waren junge Maler unzufrieden mit der akademischen Lehre, die sie Athleten der Antike zeichnen ließ. Eine Gruppe um Friedrich Overbeck und Franz Pforr scherte aus und vollzog 1809 die erste Abspaltung. Eine Sezession mit Blick zurück, bloß nicht so weit wie ihre Lehrer.
An die Stelle der Griechen trat das Mittelalter mit seinen Mythen, der behaupteten Einheit von Mensch und Natur und seiner religiösen Transzendenz. Auch die Frührenaissance akzeptierte der Lukasbund, dessen Mitglieder zwar überwiegend protestantisch waren. Mit dem Umzug in ein leer stehendes Kloster im Norden Roms konvertieren jedoch viele von ihnen, die Haare trugen sie nun lang „alla nazarena“, und die männlichen Akte ihrer Bilder durften zart und empfindsam sein.
Mit einer pointierten Gegenüberstellung der nordischen protestantischen und katholischen Bewegung sowie dem Fokus auf den Beitrag Wiens und Österreichs illustrieren die Welten der Romantik die romantische Suche nach dem Transzendenten in Mensch und Natur.